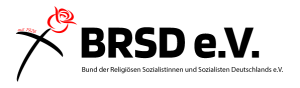Rezension zu Jürgen Manemanns Buch: “Revolutionäres Christentum”
Manemann, Jürgen: Revolutionäres Christentum. Ein Plädoyer, Bielefeld 2021, 160S.
Unser gesellschaftliches Zusammenleben befindet sich in Krisensituationen. Klimakataststrophe, Corona-Pandemie und Demokratiezersetzungen (Rechtsruck) bestimmen Alltag und Gesellschaft. Ausgehend von diesen Beobachtungen stellt Jürgen Manemann die Frage: „Aber wo sind die Christ*innen, wo ist ‚die Kirche‘?“ (13). Anstatt dass Kirche sich in zirkulärer Permanenz um die eigenen Strukturen als Institution Sorgen macht, votiert Manemann für ein revolutionäres Christentum. Theologisch wird dies mit einem Gottesverständnis begründet, das Gott als Schöpfergottheit begreift, die jegliches Ordnungsgefüge relativiert (16). Kirche hat sich einer solchen Befreiungsbewegung als „Lebensform der Auferstehung“ (25–30) zu verpflichten und sich in die Welt verstricken zu lassen (30–36). Dazu braucht es Mut, Mitleidenschaft sowie Realitätsbezogenheit – anders ausgedrückt: Kirche bangt wie der Prophet Amos um sein Volk und handelt (36–39).
Eine solch revolutionäre Ausrichtung ist geprägt von Mut zur Trauer, die in der Vulnerabilität aller Menschen Solidarität und widerständiges Handeln entfacht. Sie hält an der Utopie fest (unser Zusammenleben könnte und soll anders sein), baut handlungszermürbende Zukunftsängste ab und sagt „was an der Zeit ist, und zwar schonungslos“ (61).
Das Feld der Widersacher wird von Manemann klar benannt. Ein revolutionäres Christentum kehrt sich ab von einer „kapitalistischen Sachherrschaft“, die Menschen und Natur wie einen toten Stoff behandelt und Potential zum Faschismus und Totalitarismus innehat (63–69). Eine „Revolution für das Leben“ richtet sich hingegen auf solidarische Beziehungen (auch mit Natur und nichtmenschlichen Lebewesen) aus und strebt eine Befreiung aller Dimensionen des Lebens an. Hier gilt insbesondere die Eigentumslogik des Kapitalismus zu überwinden – Eigentum dient dem Allgemeinwohl (74–85). Weitere Merkmale einer solchen befreienden Revolution (87‑113) sind eine sorgende Solidarität (die auch für ihre Toten eintritt), die Bekämpfung des weißen männlichen Rassismus in der Kirche und eine Leidenschaft für Demokratisierungsprozesse (Leidempfindlichkeit und Differenzsensibilität). An dieser Stelle lässt der Verfasser eine Verhältnisbestimmung von Demokratie und Eigentum bzw. Ökonomie vermissen: Was bedeutet es, wenn wirtschaftliches Handeln und die Verwendungsweise von immer knapper werdenden Ressourcen demokratisiert werden? Hier hätte der Verfasser mit aktuellen linken und sozialistischen Debatten in Begegnung treten und damit außer-theologische Netzwerke etablieren können, die genau eine solche Richtung und Linie verfolgen (z. B.: Raul Zelik, Klaus Dörre oder das ökosozialistische Netzwerk um Bruno Kern). Die von Manemann gestellte Forderung einer „Konsultativen“ (BürgerInnenräte) lässt eine solche Tendenz zumindest anklingen (137).
Bemerkenswert ist, dass sich Manemann für einen zivilen Ungehorsam ausspricht und eine „Cop Culture-Szene“ innerhalb der Polizei, die Bürger als Herrschaftsobjekte interpretiert, stark kritisiert (115–131).
Insgesamt hat Manemann ein wichtiges und hoch aktuelles Plädoyer verfasst, das Kirche und Christen wachrütteln will, sich für das Leben und für die Menschen in Anbetracht von dramatischen Krisen einzusetzen. Dies entspricht ihrem Auftrag und wirkt dem aktuellen Relevanzverlust von Kirche entgegen.
Diese Rezension ist bei der Zeitschrift micha.links (01/2022, S.31) erschienen.